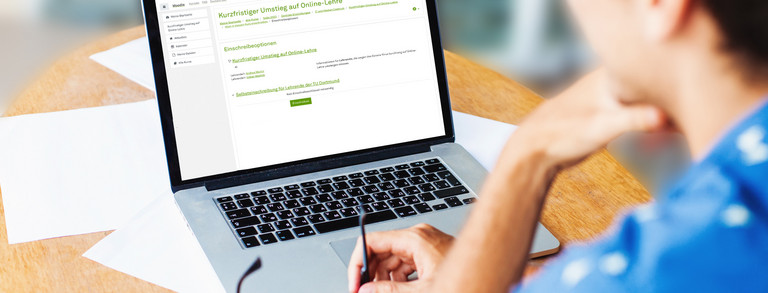„Mir ist es einfach ein Anliegen, dass es mehr Gründungen gibt.“

Stell dich gerne vor. Wer bist du? Was ist deine Vorgeschichte? Wer sind deine Teammitglieder?
Philipp: Hi, ich bin Philipp und habe bei der Logistikbude die Rolle des CEO inne. Ich habe zusammen mit meinen Co-Foundern Jan, Patrik und Michael gegründet. Wir haben zuvor viele Jahre am Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik (IML) Unternehmen zu allen möglichen Fragestellungen rund um Mehrwegverwaltung und -verfolgung beraten. Dabei haben wir gemerkt, dass die Technologien, um die Prozesse zu vereinfachen, zwar da sind, es bisher aber nicht möglich war diese in den Unternehmen auch umzusetzen- es fehlte quasi ein Puzzlestein. Also Prozesse, Technologien und irgendwo dazwischen ein Stück Software - möglichst einfach einzusetzen, weil kein Unternehmen der Welt Zeit und Lust hat, Mehrweg zu verwalten, das ist nun mal eher Mittel zum Zweck. Wir haben drei Technologiestränge zusammengeführt und anschließend im Oktober 2021 unser Unternehmen gegründet. Im Januar 2022 sind wir live gegangen und mittlerweile sind wir bei einer zweistelligen Kundenzahl, die unsere Software operativ nutzt. Unsere Kunden kommen dabei in der Regel aus der Produktion und der Logistikbranche.
Hattest du schon immer den Wunsch zu gründen?
Philipp: Ja, bei mir persönlich war der Wunsch schon vor der Gründung der Logistikbude da: ich habe während des Logistik-Studiums an der TU Dortmund immer mal wieder gebrainstormt, die Ideen dann aber nie in die Realität umgesetzt. Nach dem Studium habe ich die „normale“ Wissenschaftskarriere beim Fraunhofer begonnen. In der Zeit habe ich mit der doks.innovation GmbH schon ein Unternehmen gegründet. Dabei ging es darum, mit einer Drohne durch das Lager zu fliegen und die Inventur zu automatisieren. Irgendwann bin ich aus dem Unternehmen ausgestiegen, hatte aber relativ schnell wieder Lust, was Eigenes zu machen. Da traf es sich gut, dass wir vier uns bei Fraunhofer gefunden haben und die drei auch große Lust hatten eine Gründung anzugehen. Das Hauptprojekt aus dem unser Start-up hervorging war ein Projekt mit EPAL, der European Pallet Association, der Vereinigung hinter der Europalette. Nach erfolgreichem Projektabschluss, inklusive Pilotierung, kam die Frage auf, wie es nun weitergeht. Da haben wir unser Interesse bekundet und sind sehr dankbar, dass wir schlussendlich darauf unser Unternehmen aufbauen durften.
Welchen wissenschaftlichen Background habt ihr? Also alle denselben, oder deckt ihr verschiedene Bereiche ab?
Philipp: Wir haben alle vier an der TU Dortmund studiert. Jan und Patrik haben Angewandte Informatik studiert. Die beiden teilen sich bei uns auch den ganzen Part Softwareentwicklung - wir trennen das nach Frontend, also alles was man sieht, wie z. B. Website und App und das Backend-System, also Cloud-Architektur und Schnittstellen. Michael hat Wirtschaftswissenschaften und Wirtschaftsingenieurwesen studiert. Er ist eher der Typ für Prozesse, er verantwortet die Prozesse innerhalb der Logistikbude und betreut unsere Kunden. Ich habe Logistik studiert und habe meine Promotion über die Europalette geschrieben.
Wie funktioniert euer entwickelter Prozess genau?
Philipp: Grundsätzlich müssen wir zunächst über Mehrweg reden.
Wir verstehen das Thema B2B-Mehrweg sehr breit: von den logistischen Objekten wie z. B. Europaletten, Gitterboxen und Behältern bis hin zu den Dingen, die die Leser*innen des Interviews aus dem privaten Umfeld kennen, wie z. B. Getränkekisten oder Mehrweg-Boxen für Speisen, wie wir sie ja auch aus der Dortmunder Mensa kennen. Wir machen Software, um all diese Objekte möglichst einfach und automatisch zu verwalten.
Unsere Kunden stehen vor der Herausforderung, Mehrweg verwalten zu müssen. Ihnen gehören die Objekte und diese bewegen sich zwischen den eigenen Standorten, Kunden und Lieferanten. Daher muss jedes Unternehmen sicherstellen, dass es diese möglichst schnell wieder bekommt, damit das Objekt seinen eigentlichen Zweck erfüllt. Dazu gehört z. B. auch verwalten zu können, wie lange das Mehrweg-Objekt schon bei jemandem steht und wofür er dieses eigentlich nutzt. Wenn man dies nicht im Griff hat, wird man häufig Mehrweg-Objekte nachkaufen müssen. Es geht also darum a) das Kapital sinnvoll zu nutzen, ohne etwas zu verlieren und b) den benötigten Personalaufwand so gering wie möglich zu halten.
Wir bieten unseren Kunden hierfür einen technologieunabhängigen Ansatz und lassen ihnen die Wahl zwischen Mengenbuchung, Track & Trace und IoT. Die Daten kommen aus unserer Software oder per Schnittstellen aus den Kundensystemen. Uns ist wichtig, dass Daten nicht mehrfach generiert oder angefasst werden müssen.
Mittlerweile haben wir einen Kundenstamm von der kleinen Spedition bis hin zu Konzernen wie Siemens oder DB Schenker. Mit unserer Software werden u. a. Kino-Mehrwegbecher, Cargobikes oder Paletten verwaltet.
Mehrweg ist eben ein Thema, mit dem sich jeder beschäftigen muss, ob als Unternehmen oder auch als Privatperson: wie möchtest du etwas wiederbekommen, wenn du dir nicht notierst, wem du wann ein Buch oder eine DVD geliehen hast? Das gleiche gilt, natürlich in viel größeren Mengen, auch in der Logistik.
Ich wollte gerade nach einer Erklärung für Personen abseits der Logistik fragen. Das ist eine sehr gute Erklärung dafür.
Philipp: Die zweite Form der Erklärung, die meistens funktioniert, ist das Thema Bierkästen: Jeden Sommer wird in den Nachrichten darüber berichtet, dass den Brauereien die Bierkästen ausgehen. Hintergrund des Ganzen: wir konsumieren etwas, die Kiste ist leer und wandert in die Ecke. Wir nehmen vielleicht auf dem Nachhauseweg nach der Arbeit eine neue Kiste mit nach Hause und wenn die leer ist, wandert sie wieder in die Ecke. Irgendwann türmen sich dann diese Kisten, bis jemand genug von dem Anblick hat oder eben die Brauereien über die Medien zur Rückgabe auffordern.
Genau dasselbe passiert auch in der Logistik. Nehmen wir z. B. den Transport eines Fensters. Dieses wird auf einem Gestell zur Baustelle gefahren und irgendwann verbaut. Das Gestell steht dort erst einmal herum, bis sich jemand aus der Firma, der das Gestell gehört, meldet und es abholen lässt. Mit unserer Technologie können wir solche Rückholprozesse automatisieren und gleichzeitig anzeigen, wo genau es gerade seit wann steht.
Welche Erfolge konntet ihr bislang schon feiern – abgesehen von den bereits gewonnenen Kunden?
Philipp: Worauf wir besonders stolz sind: wir haben Mitarbeiter*innen, die ihr Geld bei uns verdienen und schaffen Arbeitsplätze. Es ist ein gutes Gefühl, aber auch eine große Verantwortung. Darüber hinaus macht es uns als junges Unternehmen natürlich stolz, Kund*innen zu begeistern - am Ende zeigt sich das auch in wirtschaftlichem Erfolg. Es ist halt ein Geschäftsmodell und ein Geschäftsmodell besteht nun mal aus Zahlen, d. h. es geht auch darum Geld, zu verdienen.
Wir haben auch viele Partnerschaften und Unterstützungen bekommen und sind Teil vieler interessanter Netzwerke geworden. Auf dieser Reise durften wir viel lernen und freuen uns darüber sehr. Zu guter Letzt ein ganz frisches Stolz-Gefühl: Wir haben aktuell eine größere Akquise laufen und jemand, der Interesse hat mit uns zusammen zu arbeiten, hat zwei bestehende Kunden um eine Referenz gebeten. Er schrieb uns danach dann eine Mail, dass die Referenzen durchweg positiv waren. Sogar so positiv, dass es fast unglaubwürdig war. Und wir haben unseren Bestandskunden vorher nichts vorgegeben, sie nur gebeten, ehrlich von sich aus zu erzählen. Dabei ging es dann auch nicht nur um die Technik, sondern vor allem um die Zusammenarbeit mit uns. Und die Kunden haben nicht nur zu einer Person von uns Kontakt, das geht durch alle Verantwortlichkeiten, ob Vertrieb, Onboarding oder Technik – da bin ich stolz auf uns als Team.
Wie ist euer Name entstanden?
Philipp: Es gibt zwei Varianten der Entstehungsgeschichte.
Fangen wir mit der offiziellen Version an: Der Kiosk ist im Ruhrgebiet die Bude und die steht dafür, dass man auf kleiner Fläche ein breites Warensortiment findet und unkompliziert einkaufen kann. Das ist auch die Idee unserer Software, wir wollen logistische Software mit einer einfachen Bedienung, die man leichter einkaufen und somit ins Unternehmen bringen kann, als die übliche Software.
Die inoffizielle Geschichte ist wie folgt: Wir hatten damals unseren allerersten Businessplan aufgestellt und den dann an Michael ten Hompel (Anm. d. Red.: Prof. Dr. Michael ten Hompel ist Inhaber des Lehrstuhls für Förder- und Lagerwesen der Fakultät Maschinenbau der TU Dortmund und Institutsleiter am Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik IML) geschickt. Der sagte dann „Jungs, coole Nummer - aber denkt noch mal an eure Finanzzahlen. Ihr wollt ja schließlich keinen Kiosk aufmachen.“ Danach haben wir uns ein wenig flapsig den Arbeitstitel „Logistikbude“ gegeben. Irgendwann ging es an die Namensfindung und wir haben sämtliche Methoden genutzt, die es dafür gibt. Da kamen Sachen bei rum wie „smart track“. Die Namensvorschläge haben wir immer bewertet und die Top 3-Namen auf eine Tafel geschrieben. Nur, dass wir diese Namen bis zur darauffolgenden Woche immer wieder vergessen hatten – bis auf die Logistikbude. Deshalb wurde es dieser Name.
Kommen wir mal zu nicht so schönen Seiten der Gründung – gab es schon Stolpersteine auf eurem Weg?
Philipp: Klar! Wobei ich finde, dass es sowohl bei den positiven als auch bei den negativen Sachen so wenig richtig große Dinge gibt. Es ist immer ein Prozess und von außen betrachtet sieht man die Entwicklung ganz anders als im daily business. Das ist ein bisschen so, wie wenn die Großtante nach zwei Jahren mal wieder zu Besuch kommt, das Kind anschaut und sagt „oh, bist du aber groß geworden!“ Und die Eltern, die das Kind jeden Tag sehen und den Prozess des Wachsens miterleben, nehmen das gar nicht so stark wahr.
In meinen Augen ist der Aufbau eines Unternehmens ähnlich. Als Gründer sieht man gar nicht diese großen Veränderungen, aber von außen wird gespiegelt, wenn etwas echt gut läuft.
Wenn ich aber ein Beispiel für einen Stolperstein nennen müsste, fallen mir direkt die ersten Kundenverhandlungen ein. Die haben wirklich keinen Spaß gemacht, wenn du noch keinen Kunden oder gar keine Referenz hast. Dann passieren so Sachen, dass du im Vertrieb einen Preis für dein Produkt nennst und nur noch „ein kleines Gespräch“ mit dem Einkauf notwendig ist. In diesem wirst du dann aber komplett auseinandergenommen und am Ende bist du froh, dass du überhaupt anbieten darfst. So lief das bei einer unserer ersten Verhandlungen.
Auch das Thema Personal ist ein schwieriges. So mussten wir uns von zwei Mitarbeiter*innen trennen, weil es von beiden Seiten einfach nicht gepasst hat. Ich glaube, das ist so das Härteste was wir bisher durchmachen mussten, weil es direkt um Menschen ging. Wenn man da nicht mal eine Nacht unruhig schläft, ist irgendwas falsch gelaufen.
Wie habt ihr es geschafft, eure ersten Kunden zu bekommen, wenn es noch keine Referenzen gab?
Philipp: Unser erster Kunde war derjenige mit den Cargobikes. Die Fahrer holen morgens die Räder aus dem Depot ab und fahren die abends wieder rein. An den Fahrrädern geht häufiger irgendetwas kaputt – ein Reifen platzt, die Bremse ist kaputt, was auch immer. Die Firma hat das in den Depots alles auf Papier festgehalten. Es gab quasi keine Gesamtübersicht darüber, wie viele Fahrräder gerade wo verfügbar sind. Wir konnten der Firma direkt eine Lösung geben, um das Organisationsproblem in den Griff zu bekommen, so haben wir sie als ersten Kunden gewonnen und so ging das dann Schritt für Schritt weiter.
Wie geht man mit Hindernissen um? Was macht ihr, um euch von dem Gründer*innenalltag abzulenken?
Philipp: Es gibt zwei Seiten, einmal die Gründer*innen untereinander und dann das Privatleben.
Unter uns Gründern hilft uns eine total ehrliche Offenheit. Wenn wir die Jahresstrategie planen, geht es z. B. schonmal hitzig zu, da sitzt dann nicht jeder mehr entspannt am Tisch, der eine läuft auf und ab, der andere sitzt auf dem Boden, da jeder eine eigene Idee und teils andere Meinung hat. Wenn wir danach aber den Raum wieder verlassen, haben wir uns geeinigt und alles ist gut. Ich glaube, Offenheit miteinander hilft, schwierige Sachen zu verarbeiten. So etwas wie Personalauf- oder auch -abbau, das gehört als Unternehmen dazu. Wir haben ein extrem gutes und gleichzeitig professionelles Verhältnis zueinander, aber ich würde niemandem raten, ein Unternehmen mit den besten Freunden zu gründen.
Privat hat jeder von uns seine eigene Strategie, um mit Stress klarzukommen, der eine kocht gerne, der andere spielt Klavier, der nächste spielt Fußball. So kommt jeder von uns auf zwei, drei Hobbies zum Abschalten. Die machen wir in der Regel auch nicht zusammen. Auch wenn wir einen hohen HomeOffice-Anteil haben, ist es schon gut, wenn man die anderen nicht auch noch abends oder am Wochenende sieht.
Für mich persönlich ist Arbeit selten Stress gewesen, ich habe das, was ich so tue, immer gerne gemacht. Mein Motto war eher, wenn ich einen Job rein aus Pflichtbewusstsein machen würde, würde ich das nicht mehr machen wollen.
Jetzt hilft es natürlich, dass wir nicht eine schwarzweiß Work-Life-Balance haben. Ich kann bspw. mittags mal zwei Stunden einkaufen und mache dafür abends weiter. Und darüber hinaus ist in meinen Augen für den Erfolg eines Start-ups auch der Rückhalt aus dem privaten Umfeld entscheidend, da unsere Arbeitszeiten schon ein wenig länger sind.
Du rätst von einer Gründung mit den besten Freund*innen ab - würdest du dennoch sagen, man sollte lieber im Team gründen?
Philipp: Unbedingt! Man braucht mehrere Menschen, um allen Aufgaben gerecht zu werden. Du brauchst im Team Menschen mit verschiedenen Interessen und Fähigkeiten, wenn das alles einer in sich vereinen würde, wäre das ein Übermensch.
Außerdem hilft es total, sich offen und ehrlich austauschen zu können und das geht mit Angestellten nicht.
Man sollte aber mit der Anzahl der Gründer*innen nicht übertreiben. Zehn Gründende im Unternehmen ist nicht gut, vor allem wenn man irgendwann Geld einsammeln will. Aber alles zwischen drei und maximal fünf Personen halte ich für eine gute Größe. Darüber hinaus würde ich noch aufpassen, dass das Founder-Team heterogen ist, nicht aus allzu ähnlichen Charakteren besteht.
Hast du noch weitere Tipps für Gründer*innen?
Philipp: Mein Lieblingstipp ist einer, den ich selbst hart lernen musste: Ein Geschäftsmodell besteht aus Zahlen.
Während des Studiums und zu Beginn einer Gründungsidee liest man ein bisschen Literatur dazu und findet Unmengen zu theoretischen Geschäftsmodellen wie Razor und Blade, Pay-per-Use usw.. Das ist alles schön und gut, aber am Ende ist es die Aufgabe etwas zu bauen, was Geld erwirtschaftet. Und das funktioniert nur, wenn man die Unit Economics (= Verhältnis Customer Value zu Acquisition Costs) im Griff hat. Idealerweise amortisiert sich dabei ein Kunde in unter 12 Monaten, egal, ob es am Ende ein Produkt ist, was 30 Euro oder 3 Millionen Euro kostet. Ich glaube, dass man an Universitäten viel zu wenig über die eigentliche Wahrheit spricht: ein Geschäftsmodell muss Geld verdienen. Das klingt total unsexy, aber so ist es nun einmal.
Hattet ihr in eurer Anfangszeit der Gründung Mentor*innen, oder auch Vorbilder?
Philipp: Mir persönlich hat nie so ein abstrakter Gründer wie Elon Musk oder Jeff Bezos geholfen. Ein paar Lebensläufe finde ich ganz interessant, aber mir hat eher ein vielfältiges Netzwerk etwas gebracht. Wir hatten damals einen extrem guten Coach und das ist auch gleichzeitig mein Tipp: Nimm nicht jeden Coach! Häufig coachen Coaches zu Themen, die sie selbst nie als Beruf ausgeübt haben. Das ist ein bisschen so als würde man das Autofahren von der Rückbank aus lernen wollen. Das klappt einfach nicht.
Wir hatten jedenfalls einen Coach, der selbst ein Unternehmen aufgebaut und bis zum IPO (Börsengang) geführt hat. Mit dem haben wir Gespräche geführt und ihm unsere Ideen vorgestellt und er hat on-point seine Fragen gestellt, sodass wir ins Grübeln kamen. Und genau das macht in meinen Augen ein gutes Coaching aus: man muss selbst ins Grübeln kommen.
Außerdem ist ein gutes Netzwerk wichtig. Unser damaliger Abteilungsleiter war eine sensationelle Führungskraft, da haben wir uns viel abgeguckt was die Unternehmenskultur angeht. Zusammenfassend habe ich also nicht ein besonderes Vorbild, sondern eher viele verschiedene, bei denen man sich Sachen raussucht, die für sich persönlich passen.
Glaubst du, in fünf Jahren wird jemand hier sitzen und sagen „mein Vorbild sind die Jungs, die die Logistikbude gegründet haben“? Und wo steht ihr dann?
Philipp: Für mich wäre es schön Teil eines echten Netzwerkes zu sein.
Es ist stumpf, auf einzelne Unternehmen zu schauen, sondern viel interessanter ist es doch, dass ein Kosmos entsteht, der die Leute inspiriert selbst zu gründen.
Ich glaube, in Deutschland wurde sich zu lange auf dem Wohlstand ausgeruht und darauf, dass wir Weltspitze sind. Wir hängen mittlerweile sehr stark von alten Technologien ab. Neben dem Wandel von bestehenden Unternehmen schadet es schließlich nicht, wenn es neue Unternehmen gibt. Die Überlegung muss sein, ob man das 27. Mal Geld in Warenhäuser in der Innenstadt investiert, um sie doch noch zu retten oder ob man nicht das Geld nimmt, damit neue Sachen entstehen können.
Für mich wäre das Schönste, wenn irgendjemand mal sagt „hey, ich habe damals einen Kaffee mit euch getrunken und das Gespräch mit euch hat mich so inspiriert, dass ich jetzt gründen will“. Also wenn jemand ernsthaft Interesse an einer Gründung hat, kann die Person sich immer gerne bei mir melden. Mir ist es einfach ein Anliegen, dass es mehr Gründungen gibt.
Ansonsten wo stehen wir in fünf Jahren? Jetzt könnte ich unseren Businessplan runterrasseln und natürlich haben wir Ambitionen da mehr rauszumachen. Toll wäre es, wenn es nicht nur die Software wäre, sondern ein großes Netzwerk für Mehrweg. Am Ende ist es Wahnsinn, was da draußen passiert: Wir reden über fünf Milliarden Mehrweg-Objekte in der Logistik in Europa. Das sind über 200 Milliarden Euro und rund 40 Prozent davon stehen leer herum und erfüllen somit nicht ihren eigentlichen Zweck. Darüber hinaus gehen 20% jährlich kaputt oder verloren und müssen nachproduziert werden. Das ist weder ökologisch noch ökonomisch.
Wie baut ihr euer Netzwerk auf?
Philipp: Ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass du authentisch bist. Wenn man bspw. mit neuen Menschen in Kontakt treten will sollte die Nachricht nicht allzu förmlich sein, wenn man das im echten Leben auch nicht ist. Gleichzeitig würde ich immer ehrlich dazu schreiben, was ich möchte und was die andere Seite davon hat.
Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, immer zu geben und zu nehmen.
Manchmal muss man jemanden einen Gefallen tun und sieht dann erst drei Jahre später, was daraus geworden ist.
Fairerweise muss man sagen, dass es uns extrem geholfen hat, dass wir durch das Fraunhofer-Institut schon viele Jahre mit der Industrie zusammengearbeitet haben. Ich habe wahrscheinlich so um die 50 Projekte gemacht, von Kleinstworkshops bis hin zu großen, strategischen Projekten. Es hat schon sehr geholfen, dieses Netzwerk zu haben und nicht bei null anfangen zu müssen. Und auch da hilft es, dass wir alle sehr unterschiedlich sind, denn das heißt auch, dass jeder sein eigenes Netzwerk mitbringt. Ich hätte z. B. niemanden für Software-Framework, Patrik hingegen hat da ein Riesennetzwerk, aus dem wir jetzt auch jemanden einstellen. Michael hat ein Netzwerk aus dem ganzen Apparat Steuerberatung, Buchhaltung, betriebliche Altersvorsorge etc. und ich habe einen Draht in die Logistik.
Ich glaube, schlussendlich an das Modell des Beziehungskontos: wenn man irgendwo was einzahlt, dann kann man irgendwann auch wieder etwas abheben.
Apropos Beziehungskonto, wie habt ihr vom CET erfahren?
Philipp: Das war eigentlich ganz lustig: Naomune (Anm. d. Red.: Naomune Haii, Community-Manager des CET) hat uns angerufen und wollte uns den CoWorkingSpace zeigen. Es war mitten in der Corona-Zeit und deshalb zugegeben ein wenig leer. Nach einer Führung durch die ganzen Räume standen wir vorne, haben zusammen Limo getrunken und er fragte, wie es uns so geht und wie es bei uns weiterlaufen soll.
Das passte gerade ganz gut, da wir am Ende der Phase 1 unserer EXIST-Förderung waren. Wir waren vorher 18 Monate als Fraunhofer-Mitarbeiter freigestellt, um das Start-up aufzubauen, aber für danach war klar, dass wir die Mauern des Fraunhofer verlassen werden. So hat uns das CET aufgenommen und das Netzwerk hier ist echt toll. Andauernd sind hier verschiedene externe Gruppen zu Gast und wir bekommen regelmäßig die Möglichkeit, unser Unternehmen vorzustellen. So war z. B. erst vor kurzem eine Delegation von Miele hier. Darüber hinaus kommt man sehr schnell und unkompliziert mit den anderen Start-ups in Kontakt und kann sich so zu aktuellen Fragestellungen austauschen. In meinen Augen ist das CET sehr gut darin das Ganze als eine Art Lebenszyklus zu begreifen: Die Studierenden, im besten Sinne, anzulocken, zumindest den Gedanken zu pflanzen, dass eine Gründung durchaus ein guter Karriereweg ist und dann dabei zu begleiten, wenn die Teams die ersten Schritte machen. Dann bringen die Start-ups, die Alumni sind, nochmal was rein und ja - vielleicht könnten die dann auch eine Art Coaching machen und jüngere Teams begleiten.
Vielen lieben Dank Philipp für das Interview. Wir wünschen der Logistikbude weiterhin viel Erfolg!
Wenn Sie mit der Logistikbude in den Austausch gehen wollen oder auch Interesse an einer Zusammenarbeit haben, melden Sie sich gerne über: info@logistikbude.com